Kracht: IMPERIUM
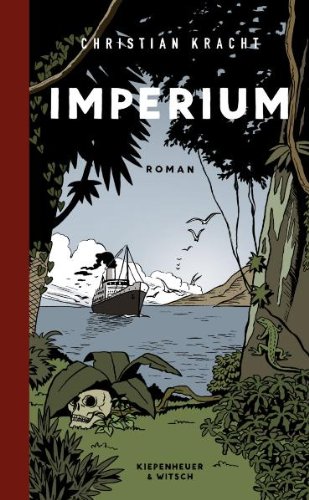
Handwerklich geschliffener Stil, opulente Sprache mit vielen Adjektiven und Adverbialkonstruktionen, die ein abfälliges Schmunzeln bzw. einen überheblichen Genuss an den fatalen Irrungen anderer vermitteln. Seine Protagonisten zu denunzieren, ist sicherlich kein Verbrechen (Heinrich Mann, Kafka, Jean Paul …). Aber Kracht tut es nicht wütend wie Goetz, nicht auf Augenhöhe. Er stellt uns einen (immerhin real existiert habenden) Fanatiker vor, der völlig weltfern eine „Individualutopie“ (Lützow, S. 173) bis zum Wahnsinn lebt, die höchste Form der Utopie wird die tiefste Barbarei, ja Autokannibalismus. Das Buch ist also „böse“, weil es Gefühle wie Häme, Verachtung, Selbstgerechtigkeit etc. als Stilmittel verwendet. Aber wohin geht Kracht‘s Interesse? Ist er Menschenverächter oder Menschenfreund? Das Buch ist hervorragend gebaut, keine Frage. Es ist überaus kohärent, will sagen: es besitzt eine geschlossene Form, was zu meinem Leidwesen ja offenbar Bedingung für Erfolg zu sein scheint, und überrascht trotzdem mit dem persönlichen Einschreiten des Autors, der einmal sogar ich sagt, also sich am Schreibtisch auch meint. Das ist souverän, das ist gekonnt, das ist sportlich. Er spielt auch mit der inzwischen eben überheblich und Einverständnis heischend anmutenden, kumpelhaften Wir-Form, die ihn und die Leserschaft auf die einverständig erfundenen (aber durchaus gleichnishaft gemeinten) Romanfiguren blicken lässt wie auf etwas in einer Petrischale. Zuerst führt das dazu, dass ich mehr lesen will von Kracht, um zu wissen, ob er sich anderswo klarer positioniert. Ich bin irritiert, denn seine Positionierung scheint handwerklich und formal so deutlich, und doch kann ich sie nicht fassen. Er macht sich lustig über diesen gefährlichen Weltverächter, und da er ihn Adolf Hitler, den er auch hauptsächlich als Würstchen beschreibt, gleichsetzt, stellt Kracht sich selbst gleich auf die korrekte Seite der Geschichte. Dennoch fühle ich mich nicht wohl mit diesem Autorenarm um meine Schulter. Vielleicht weil diese Art der Distanzierung zu einfach ist? Sich anbietet als Machtinstrument über die Figuren, die man als Autor ja sowieso hat? Wie gehe ich als Erzähler mit Macht um? Darf ich dieses Instrument, das mir als auktorialer, als gottähnlichem Autor zu Gebote steht, benutzen, um die Figuren so durch die Hölle zu schicken? Oder ist das eine lächerliche Frage, denn wo könnte Macht weniger Schaden anrichten als in bloßen Worten.
Lewitscharoff wird gerade live und in Farbe und wiederholt angespitzt und in den Boden gestampft, eben weil sie als Autorin im Wissen um die Bedeutung von Worten diese so vermeintlich leichtfertig einsetzt, und dann setzt sie sie aber genauso wieder ein und hat aus dem Dresdner „Vorfall“, den alle gern als Ausrutscher sähen, nichts gelernt oder hat die ganze Zeit (also ihr Leben lang) immer nur das Falsche gelernt und jetzt kommt‘s raus. Nein, Worte haben Gewicht.
Dann folge ich dem verunsicherten Impuls, nach Kritiken oder Besprechungen von IMPERIUM zu suchen, weil ich sehen will, was die Welt dazu gesagt hat (und finde einen Überblick bei perlentaucher). Und siehe da: die Rechtsnähe hatte in einer frühen Kritik Georg Diez herausgelesen und unterstellt, jedoch wurde dieses Urteil sogleich niedergetrampelt. Dennoch sind die Rezensionen extrem gespalten, von totaler Enttäuschung bis hin zu großem Vergnügen und Lesegenuss. Ich lese, dass Roman Bucheli (NZZ) das forciert Selbstironische als nicht fruchtbar, als ohne ästhetischen Mehrwert bezeichnet. Ich tendiere zu Enttäuschung, was etwas über mich aussagt, denn das erste, was mir einfiel, war ja Opulenz, die einem Autor wohl zu Gebote steht, aber man muss auch wissen, wieso. Als Tropismus? Dem Urteil „qualvoll“ (Andreas Fanizadeh) über den Versuch, die Sprache jener Zeit auferstehen zu lassen, schließe ich mich an. Wahrscheinlich bin ich doch im Kern eher Freund der asketischen, gerne zu ernsthaften Literatur. Und der Snobbismus, der einem Rezensenten früher bei Kracht gefallen hat, liegt mir hoffentlich sowieso fern. In meine Lektürereihe hat der Roman durch seine gewissen Parallelen zu Illies 1913 gepasst. Fazit: nicht inspirierend, aber lehrreich.
Schreibe einen Kommentar