Amerika in den Sechzigern
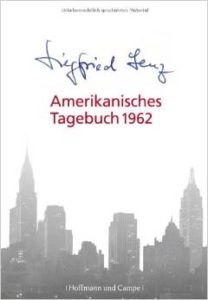
Siegfried Lenz’ AMERIKANISCHES TAGEBUCH 1962 liest sich intensiver, als ich dachte. Der Mann ist noch jung und voller Skepsis, als er seine vierzigtägige USA-Reise erlebt und schreibt. Lenz schreibt wie über einen Besuch auf dem Mars, alles ist wahnsinnig fremd, und als denkender Mensch kann er das Fremde auch orten und benennen. Er fühlt sich überall extrem gastfreundlich aufgenommen, allerdings ist ihm die Gastfreundschaft zu programmatisch, er fühlt sich – und wird auch – mit nahezu lückenlosem Programm herumgereicht. Zwar kommt er damit tatsächlich in kurzer Zeit durch sehr unterschiedliche Gebiete – zumindest geografisch. Denn das soziale Terrain der weißen Akademia verlässt er nicht. Lenz scheint ein Interesse an der zu dem Zeitpunkt extrem aktiven Bürgerrechtsbewegung zu haben, kommt damit aber kaum in Berührung. Er ist enttäuscht von der wenig tiefgründigen, oft überraschend wenig gebildeten Bildungsschicht,
die zu einem großen Teil aus emigrierten Gelehrten zu bestehen schien. So fühlt er sich rasch einsam und fremd und auch abgestoßen von amerikanischen Phänomenen wie dem, das er den horror vacui nennt: nur keine Stille aufkommen lassen, nur nicht ins Ungewisse vordringen.
Die Kubakrise war weltbeherrschend, ist aber in Lenz‘ Schilderungen eher ein Randphänomen. Auffallend ist auch die Sprache der Zeit, eine andere steht auch ihm wohl nicht zur Verfügung, als er von Rasse, von Schwarzen schreibt und sich wenig darüber auslässt, dass alle Tische und alle Aufzüge von Nichtweißen bedient werden. Das scheint aber zu täuschen, denn zum Schluss seiner Reise, in New Orleans, schreibt er, wie die Trennung zwischen Weißen und Nichtweißen sich auflöst, indem zum Beispiel Trennwände in Restaurants zum Teil schon weggenommen werden oder auch die Verkehrsmittel von Nichtweißen genutzt werden. Auch das Geschlechtermodell ist ihm wohl fremd und uninteressant: die Amerikanerinnen, schreibt Lenz, wären immer Girls, auch mit Siebzig noch.

Dazu passt, dass die Serie MAD MEN, die ich als 1960 gesetzte Serienhandlung in den letzten Tagen gesehen habe, ebenfalls und mit einiger boshaften Genugtuung einen Schwerpunkt auf die Geschlechterrollen setzt, wie sie damals in den Vereinigten Staaten wohl herrschten. Nichtweiße kommen in der ersten Staffel nur als absolute Marginalien vor: Kellner und Liftbediener. Die Serie führt uns vor Augen, dass auch die Privilegierten, Der Weiße Mann, unter diesem gesellschaftlichen Regime zu leiden hatte. Während die Szenen und Dialoge möglichst alle Tabus der political correctness brechen, die die Situationen erlauben, und wirklich gemein sein wollen, fragt man sich, ob auf dem Hintergrund der Zeit diese Beschränkung der Handlung nicht ein wenig zynisch ist. Vielleicht kümmern sich einige der nächsten Staffeln um diese Themenbereiche?
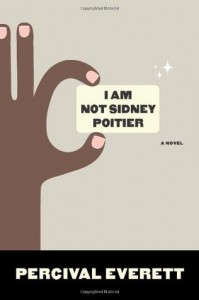

Das Buch I AM NOT SIDNEY POITIER (Percival Everett; glänzend ins Deutsche übertragen von Karen Witthuhn), ebenfalls letzte Woche gelesen, spielt etwas später in den Sechzigern und legt den Schwerpunkt wiederum ausschließlich auf die zu der Zeit in den USA herrschende Apartheid, die angesichts der zahlreichen aktuellen Gewalttaten weißer Polizisten gegen nichtweiße Bürger verübt worden sind, in denen die Polizei regelmäßig ungestraft davonkommt. Die brillant geschriebene Satire treibt ein Vexierspiel, dass sich nicht auf den ersten Blick entschlüsselt. Sie erlebt aber ihren Höhepunkt, als die Hauptfigur Not Sidney (eine literarische Gegenfigur zu dem Schauspieler Sidney Poitier) endliche initiativ wird gegen die fortwährenden Erniedrigungen und beim Thanksgiving-Essen in der Südstaatenfamilie seiner Freundin allen die Meinung sagt.
Jetzt freue mich auf den Film SELMA, der die Zeit und einige ihrer Themen abrundet.
Schreibe einen Kommentar